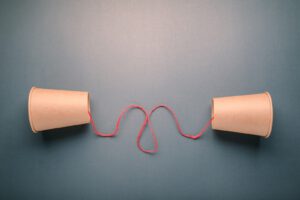Einleitung
Heutzutage zeigen sich Beratungsangebote in einer außergewöhnlichen Vielfalt. Über Jahrzehnte hin- weg trugen psychologische und sozialwissenschaftliche Disziplinen zur Entwicklung des Beratungsverständnisses bei und haben sich dabei nur teilweise aufeinander bezogen. Auch außerhalb der Beratungskonzepte dieser Disziplinen findet sich eine unüberschaubare Breite an Beratungsreflexionen (En- gel et al., 2018, S.84). Ausgehend von den mannigfaltigen Beratungsangeboten, richtet sich der Beratungsbegriff dieser Arbeit nach dem Verständnis der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB) sowie den ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) und ist somit als eine professionalisierte Form zu verstehen (DGSF, 2024).
Beratung kann von einzelnen Personen, von Gruppen oder auch Organisationen in Anspruch genommen werden. Abhängig von den jeweils zu bewältigenden Anforderungen und Problemen, lassen sich verschiedene Beratungsfelder und Beratungsansätze unterscheiden (DGfB, 2020). In dieser Arbeit werden die angeführten Gesprächstechniken im Kontext einer persönlichkeitsorientierten Beratungsrichtung betrachtet. Darunter versteht Niggemeier (2019) Beratung in beruflichen, pädagogischen sowie psychosozial-arbeitsweltlichen Zusammenhängen. Darüber hinaus unterscheidet Niggemeier die organisationsbezogene Beratungsrichtung, die sich auf die Beratung von Organisationen als System, das Management von Organisationen sowie arbeitsweltbezogene Beratungen konzentriert (S. 6). Beide Beratungsrichtungen sind dabei nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern vielmehr als ein umfassendes Beratungsverständnis, in dem sowohl Einzelpersonen als auch Systeme oder bestimmte soziale Gruppen wie Familie, Arbeitsgruppen oder Arbeitsabteilungen mit Problemen konfrontiert werden und einer Beratung bedürfen (Niggemeier, 2019, S. 12). Die dargestellte Einteilung verdeutlicht exemplarisch den Zusammenhang zwischen Einzelpersonen in ihren individuellen Lebensbereichen und deren Einbindung in Gruppen und organisierte Systeme, wie etwa am Arbeitsplatz. Über viele Jahre haben sich diese Verflechtungen durch grundlegende gesellschaftliche Wandlungen verstärkt und wurden von technologischen Entwicklungen, Krisen und neuen Möglichkeiten maßgeblich beeinflusst. Leben und Arbeiten, sofern diese Bereiche getrennt voneinander sind, wurden dadurch zunehmend vielschichtiger und komplexer. Neue oder veränderte Anforderungen werden an das Individuum herangetragen, die einerseits zu mehr Wahlmöglichkeiten führen, jedoch auch Entscheidungen und somit mehr Verantwortung mit sich bringen (Lerch & Weitzel, 2024, S. 48). Professionelle Beratung soll dazu beitragen, den Ratsuchenden angemessen in deren Individualität, Selbstreflexionsfähigkeit, Verantwortlichkeit, Teilhabe und Selbstbestimmtheit zu fördern. Der individuelle Spielraum soll durch die Eröffnung neuer Sichtweisen und Handlungsspielräume erweitert werden. Beratende orientieren sich dabei ausschließlich an den Zielen der Ratsuchenden, wobei davon auszugehen ist, dass diese Ziele zu Beginn des Prozesses erst zu erarbeiten sind (Kämpfe, 2019, S. 254). Beratung ist ein zielgerichteter und zugleich offener und dynamischer Prozess. Es existieren verschiedene theoretische Modelle, die den Beratungsablauf strukturieren, jedoch lässt sich die praktische Umsetzung nicht auf ein allgemeingültiges Schema reduzieren. Professionelle Berater und Beraterinnen bedienen sich an diesen Modellen und teilen den Beratungsprozess in Phasen, mit unterschiedlichen Beratungszielen ein (Kämpfe, 2019, S. 255-256).
Um den Prozess der Beratung im Sinne der Ratsuchenden zu gestalten, verfügen Beraterpersönlichkeiten über entsprechende fachliche, soziale, methodische und selbstreflexive Kompetenzen (Kämpfe, 2019, S. 256). Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Beratung, neben den bis hierhin genannten Aspekten und Kompetenzen, ist eine tragfähige Beziehung zwischen ratsuchender und beratender Person. Die Gestaltung einer Beratungsbeziehung ist nach Fuhr (2003, S.32) der wichtigste, aber auch schwierigste Moment im Prozess einer Beratung. In einer Beratungssituation wird die Beziehung zwischen den Akteuren meist nicht explizit er- oder bearbeitet. Sie fungiert jedoch als ein wichtiges Hintergrundphänomen, welches sich bedeutsam auf die Kommunikation und den Kontakt auswirkt (Fuhr, 2003, S. 34-35).
Im nächsten Abschnitt wird erläutert, inwieweit sich die Personenzentrierte Gesprächsführung und die Motivierende Gesprächsführung in der Beratungsbeziehung sowie in ihren Grundprinzipien und methodischen Grundlagen unterscheiden. Darauf folgt eine differenzierte Betrachtung ihrer Vor- und Nachteile sowie eine Betrachtung ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Am Ende der Arbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und mit einem abschließenden Urteil abgerundet.
Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Hintergründe der Klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers und der Motivierenden Gesprächsführung von Miller und Rollnick. Es umfasst grundlegenden Prinzipien, die beraterische Grundhaltung sowie die methodischen Grundlagen und Ziele beider Gesprächstechniken.
Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
Die Klientenzentrierte Gesprächsführung (KZG) wurde von Carl Rogers (1902-1987) begründet und ist bis heute eine der bedeutendsten Ansätze in der Psychotherapie und Beratung. Rogers vertrat die Annahme, dass Menschen ein Selbstkonzept entwickeln und das Bedürfnis nach dessen Anerkennung, Wachstum und Selbstverwirklichung haben. Wichtig sei dabei, so Rogers, dass das innere Selbstkonzept mit dem Erleben in der Außenwelt übereinstimmt, also kongruent ist. Hierfür bedarf es der Anerkennung durch sich selbst und anderer Personen, insbesondere dann, wenn eine Person das Gefühl hat, bestimmte Verpflichtungen oder Bedingungen erfüllen zu müssen, um akzeptiert zu werden, die im Widerspruch zum eigenen Selbstkonzept stehen (Gerrig, 2018, S. 524-525).
Die Theorie der KZG geht davon aus, dass emotionale Probleme und psychische Auffälligkeiten aus ungünstigen Beziehungserfahrungen hervorgehen, während sich umgekehrt bestimmte Arten von Beziehungen gesundend auf den Menschen auswirken. Der beraterische Schwerpunkt sollte demnach darauf liegen, das Verhalten der Ratsuchenden nicht als angemessen oder unangemessen zu bewerten, sondern es ohne direktes methodisches Eingreifen, also non-direktiv, zu akzeptieren (Schuster, 2020, S. 48). Diese wertfreie Herangehensweise soll zu einer professionellen Beratungsbeziehung bei- tragen, die durch bestimmte, von Rogers formulierte Merkmale gekennzeichnet ist und mithilfe weiterer Techniken entstehen kann (Weinberger, 2013, S. 31). Das Schaffen einer tragfähigen und förderlichen Beratungsbeziehung ist nach dem Konzept von Rogers möglich durch Basisvariablen wie bedingungslose positive Wertschätzung, Empathie und Echtheit/Kongruenz (Rogers, 1993, zitiert nach Fischer, 2021, S.56). Durch die Umsetzung dieser Variablen entsteht ein Prozess, in dem sich Ratsuchende zunehmend ihrer eigenen Gefühle und Erfahrungen bewusst werden. Dabei entdecken sie die Fähigkeit, ihr eigenes Entwicklungspotential zu aktivieren, um sich konstruktiv mit Problemen auseinanderzusetzen und die Inkongruenz zwischen ihrem Selbstkonzept und ihrem Erleben in der Außenwelt in Einklang zu bringen (Weinberger, 2013, S. 31).
Rogers entwickelte seine Ansätze stets weiter und koppelte seine Forschungen an die eigene Beratungstätigkeit und Psychotherapie. Durch seine Theorien der Persönlichkeit, der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Störungslehre prägte er das humanistische Menschenbild und zählt zu den Gründervätern der humanistischen Psychologie. Die Annahme der humanistischen Psychologie ist: Jeder Mensch ist Experte für seine Probleme und für seine Lösungen. Jedem Menschen wird ein Streben nach innerem Sinn zugesprochen, welcher sie zur Umsetzung und Entwicklung ihrer individuellen Fähigkeiten antreibt (Hellwig, 2020, S. 8). In der humanistischen Psychologie und nach Rogers handelt es sich hierbei um die sogenannte Aktualisierungstendenz. Sie wird als eine im Organismus jedes Menschen innewohnende Kraft bezeichnet, die zur Entwicklung aller geistigen, seelischen und körperlichen Möglichkeiten beiträgt. Ein inneres Motivationssystem, das dafür sorgt, dass Menschen sich aus sich selbst heraus entwickeln, mit all ihren Möglichkeiten und Ressourcen (Hellwig, 2020, S. 17-18).
Straumann (2007) fasst zusammen: Im Mittelpunkt der KZG stehen Erfahrungen, Erlebenszusammenhänge und Entwicklungen in Bezug auf die eigene Persönlichkeit, zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die verändernden Verhältnisse von Ökologie, Technologie, Wissenschaft und Staat (S. 641). Die Gesprächstechnik setzt somit an der Schnittstelle Person und Umwelt an und kann als Sozialisationshilfe und Aktivierungshilfe in schwer überschaubaren Situationen, Strukturen und Systemen verstanden werden. Sie stützt personale und soziale Kompetenzen und konzentriert sich auf die ganzheitlichen Entwicklungen und Veränderungen einer Person. Das Ziel dieser Gesprächstechnik ist eine mögliche Erweiterung der erlernbaren, selbst- und sozialverantwortlichen Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten einer Person im Rahmen der multifaktoriellen Lebens- und Arbeitsbedingungen (S.642).
Beraterische Grundhaltung
Um die Aktualisierungstendenz einer Person zu aktivieren, bedarf es laut Rogers eines guten Beratungsklimas (Rogers, 1991, zitiert nach Stimmer, 2020, S. 237). Hierfür ist eine förderliche Beratungsbeziehung notwendig, die durch die beraterische Grundhaltung entstehen kann und von Empathie, unbedingte Wertschätzung und Kongruenz geprägt ist (Rogers, 1985, zitiert nach Stimmer, 2020, S. 237- 238).
Unter Empathie versteht Altmann (2015) die Fähigkeit, vermutete Emotionen einer anderen Person kognitiv zu verstehen und affektiv nachempfinden zu können (S. 7-8). Mit affektivem Nachempfinden ist gemeint, den inneren Bezugsrahmen einer Person möglichst exakt, mit allen Bedeutungen und emotionalen Komponenten wahrzunehmen, fast so, als wäre man die andere Person, jedoch ohne die eigene Position aufzugeben (Rogers, 1959, zitiert nach Weinberger, 2013, S. 41). Durch diese Grundhaltung soll es der ratsuchenden Person ermöglicht werden, eigenen Empfindungen aus einer gewissen Distanz wahrzunehmen und zu reflektieren. Das innere Erleben kann hierdurch weiter eingeschätzt, differenziert, konkretisiert und mit den eigenen Wünschen und Zielen in Verbindung gebracht werden. Im Mittelpunkt der empathischen Haltung steht keine konkrete methodische Herangehensweise. Vielmehr geht es darum, zu spüren, was in der ratsuchenden Person vorgeht und welche Bedeutung es für sie hat (Weinberger, 2013, S. 41-42).
Mit der unbedingten Wertschätzung ist gemeint, eine Person ohne Vorbedingungen in ihrem Menschsein zu akzeptieren, auch wenn die gezeigten Verhaltensweisen nicht den eigenen Umgangsformen entsprechen. Diese Grundhaltung stärkt das Selbstwertgefühl, vermittelt Sicherheit und fördert somit eine verlässliche Atmosphäre und stabile Beratungsbeziehung, die für einen Veränderungsprozess notwendig ist (Stimmer, 2020, S. 239). Alle Gefühle, ob positiv oder negativ, werden von der beratenden Person bedingungslos angenommen. Das Gegenüber empfindet dadurch kein Bedürfnis, negative Gefühle zu verteidigen und erhält die Gelegenheit, sich selbst authentisch zu verstehen und zu erleben (Rogers, 1972, zitiert nach Weinberger, 2013, S. 61-62). Die unbedingte Wertschätzung ist eng mit der Grundhaltung der Kongruenz verbunden und kann kaum von dieser getrennt werden (Weinberger, 2013, S. 60). Biermann-Ratjen et al. (2003) betonen, dass die unbedingte Wertschätzung von einem echten Verstehen der ratsuchenden Person abhängig ist. Hat die beratende Person Schwierigkeiten, das Gegenüber zu akzeptieren und anzunehmen, signalisiert dies deutlich, dass die Person nicht vollständig verstanden wurde (zitiert nach Weinberger, 2013, S. 63). Folglich ist ein weiteres Einfühlen in die Person notwendig (Weinberger, 2013, S. 63).
Kongruenz kann als Echtheit verstanden werden und meint die Übereinstimmung von Gedanken und Gefühlen mit dem, was verbal oder nonverbal geäußert wird. Kongruent sein bedeutet, dass die beratende Person gegenüber dem Gesprächspartner keine Rolle einnimmt, sondern eigene Gefühle und Einstellungen zunächst bewusst und unverzerrt wahrnimmt und diese dann in einer angemessenen Weise transparent macht (Stimmer, 2020, S. 239). Einer Person gegenüber echt zu sein und ihr als ein um Offenheit bemühter Mensch zu begegnen, ist von grundlegender Bedeutung. Nur so kann sich eine Person vertrauensvoll und ebenso kongruent zu erlebten Gefühlen und Problemen äußern. Ist die Beratungsbeziehung kongruent, kann die ratsuchende Person die ihr entgegengebrachte Wertschätzung annehmen und erleben (Weinberger, 2013, S. 66-67). Kongruenz zeigt sich in einem Gefühl von Sicherheit, das durch den Beratungsprozess, die Beratungsbeziehung und die Rahmenbedingungen beeinflusst wird und sich langsam entwickelt. Eine authentische und kongruente Grundhaltung ist daher ein anzustrebendes Ziel (Schulz von Thun, 2010, zitiert nach Weinberger, 2012, S. 67).
Methodische Grundlagen und Ziele
Die beraterische Grundhaltung mit den Komponenten Empathie, unbedingte Wertschätzung und Kongruenz bildet die Grundlage für den effektiven Einsatz der Gesprächstechniken nach Rogers. Ohne diese Haltung bleibt der Einsatz der Methoden wirkungslos und verhindert ein gelingendes und stimmiges Beratungsgespräch (Büttner & Quindel, 2013, S. 56). Zu den methodischen Grundtechniken der KZG gehören Aktives Zuhören, Paraphrasieren und Verbalisieren (Büttner & Quindel, 2013, S. 52).
Aktives Zuhören ist nach Plate (2021) ein Vorgehen, in dem der ratsuchenden Person mit voller Aufmerksamkeit begegnet wird. Dabei steht ein aktives Anteilnehmen durch nonverbale und paraverbale5 Signale im Vordergrund, wie etwa durch Blickkontakt, Kopfnicken, Lächeln oder kurze bestätigende Lautäußerungen (S. 53). Aktives Zuhören signalisiert Zuwendung, Interesse und die Bereitschaft, sich den Problemen des Gegenübers anzunehmen, wodurch die Beratungsbeziehung gestärkt und Ver- trauen aufgebaut wird (Lammers, 2017, S. 104-105). Gleichzeitig wird die Eigeninitiative der ratsuchenden Person gefördert, indem sie dazu ermutigt wird, Anliegen selbst zu formulieren. Dies entlastet auch die beratende Person, da sie nicht unmittelbar handeln oder Lösungen präsentieren muss (Büttner & Quindel, 2013, S. 108).
Das Paraphrasieren ist, ebenso wie das Verbalisieren, eng mit der Grundhaltung der Empathie verbunden. Zusammengenommen werden diese Methoden auch als Spiegeln bezeichnet (Büttner & Quindel, 2013, S. 57). Unter Paraphrasieren wird das Aufgreifen und Wiedergeben von inhaltlich wichtigen Aus- sagen verstanden. Die beratende Person versucht, das Gesagte der ratsuchenden Person mit eigenen Worten wiederzugeben. Dies sollte inhaltlich neutral und ohne die eigene Sichtweise auf die Problemlage geschehen (Büttner & Quindel, 2013, S. 111). Dieses Spiegeln vermittelt den Gesprächspartnern das Bemühen um Verständnis, wodurch gesagte Inhalte weiterentwickelt und präzisiert werden können (Weinberger, 2013, S. 53). Die ratsuchende Person erhält zudem die Möglichkeit, ihre eigenen Anliegen und Aussagen konkreter wahrzunehmen und auf Missverständnisse zu überprüfen (Büttner & Quindel, 2013, S. 111).
Beim Verbalisieren werden die emotionalen Inhalte hervorgehoben, die sich hinter den Aussagen der ratsuchenden Person verbergen. Hinweise zum emotionalen Empfinden einer Person können durch Körpersprache, Stimmlage oder auch durch die Wortwahl (z.B.: „eigentlich schon.“) gegeben sein. Demnach gilt ein besonderes Augenmerk auf vermutete Gefühle, die eine Person nur indirekt äußert oder zeigt. Das Verbalisieren von emotionalen Inhalten bedarf einer sensiblen Herangehensweise und eigene Interpretationen sollten möglichst vermieden werden. Andernfalls kann es zu Widerständen und emotionalen Gegenreaktionen kommen, die den Beratungsverlauf gefährden (Büttner & Quindel, 2013, S. 112). Verbalisieren ermöglicht es, die mit einer Aussage verbundene Emotionen wahrzunehmen und zu überprüfen. Zusammenhänge zwischen dem inneren Erleben und den äußeren Konflikten oder Schwierigkeiten werden entdeckt. Die intensive Auseinandersetzung mit emotionalen Themen wird ermöglicht (Rogers, 2007, zitiert nach Büttner & Quindel, 2013, S. 112). Besonders nonverbale bzw. paraverbale Indikatoren haben eine wichtige Bedeutung für das verbalisieren von Gefühlen. So lassen sich beispielsweise innere Unsicherheit erkennen, wenn Aussagen der ratsuchenden Person nicht mit der Körpersprache oder der Stimmlage übereinstimmen, also nicht kongruent sind. Diese Widersprüche sollten bemerkt und rückgemeldet werden. Das Benennen dieser unterschiedlichen Botschaften ermöglicht es, beide Aspekte zu erkennen und die unter der Oberfläche liegende Emotionen zu erkennen (Büttner & Quindel, 2013, S. 113).
Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, setzt die KZG einen Prozess in Gang, wenn die beschriebenen methodischen Grundlagen im Einklang mit der beraterischen Grundhaltung angewendet werden. Ratsuchende Personen werden sich dabei zunehmend ihrer eigenen Gedanken und Gefühle bewusst, welche ihnen zuvor gar nicht oder nur verzerrt zugänglich waren. Inkongruenzen werden hierdurch abgebaut, Gefühle und Erfahrungen werden schrittweise in das Selbstkonzept integriert, welches sich dadurch allmählich reorganisiert (Weinberger, 2013, S. 31).
Vorteile
Die KZG zeichnet sich besonders durch eine empathische, wertschätzende und kongruente Beratungsbeziehung aus. Diese Haltung wirkt einer schematischen Anwendung von Gesprächstechniken entgegen und ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit den emotionalen Aspekten herausfordernder Themen (Büttner & Quindel, 2013, S. 60). Die beratende Person begleitet diesen Prozess ohne Interpretationen, Ratschläge oder fertige Lösungen vorzugeben. Dies ermöglicht der ratsuchenden Person, ihre eigenen Wege und Betrachtungsweisen zu finden (Weinberger, 2013, S. 35). Mit diesen individuell auf die eigene Situation zugeschnittenen Lösungen bewegt sich die Person folglich innerhalb ihrer Handlungsmöglichkeiten. Dies bietet ihr Sicherheit und Orientierung (Hellwig, 2022, S. 40). Die KZG bietet die Chance, die eigenen Motive und verborgenen Potentiale zu entdecken und zu entfalten (Hell- wig, 2017, S. 83) Die Wirksamkeit der KZG wurde in einigen Studien belegt und von Grawe et al. (1994) in einer Übersichtsarbeit nachgewiesen. Unter den humanistischen Therapieformen, konnte mit 37 verwertbaren Studien, die Gesprächstherapie als wirksam belegt werden (zitiert nach Revenstorf, 2009, S. 298).
Nachteile
Empathie, Wertschätzung und Kongruenz wirken sich positiv auf die Entwicklung einer Person aus, dies gilt bereits als bewiesen. Dennoch erfordert die Gesprächstechnik eine Auseinandersetzung mit diesen Begriffen, da ihre Bedeutungen eher abstrakt sind und das Definieren von Beratungszielen erschweren. Der Ansatz bietet zudem nur begrenzt praktische Hilfestellungen für die ratsuchende Person, Handlungsalternativen zu entwickeln, um die belastenden Situationen im Alltag bewältigen zu können (Büttner & Quindel, 2013, S. 60-61). Beziehungsarbeit bedeutet, einer Person nahe zu sein, wodurch intensive Gefühle entstehen können, die als belastend empfunden werden können. Die Verantwortung für das Gelingen einer guten Beratungsbeziehung kann großen Druck auslösen. Die beraterische Grundhaltung kann besonders anfänglich das Gefühl hervorrufen, sich selbst als Berater oder Beraterin verleugnen zu müssen, da sie den Eindruck vermitteln, für alles Verständnis aufbringen zu müssen, auch wenn man keines hat. Auch Zurückweisungen oder verschlossenes Verhalten einer ratsuchenden Person können als verletzend empfunden werden. Die KZG erfordert somit eine Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten, die in der Beratungstätigkeit und ohne Vorerfahrung auftreten können (Weinberger, 2013, S. 180-181). Für eine kongruente Haltung ist es zudem erforderlich, eigene Einstellungen und Wertvorstellungen zu hinterfragen, um zu verstehen, weshalb man manchen Sichtweisen und Haltungen ablehnend begegnet. Diese Ablehnungen, so Weinberger (2013), können nicht mit einer einfachen Wortwahl überspielt werden. Ratsuchende Personen werden diese Unaufrichtigkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit spüren (S. 187).
Motivierende Gesprächsführung nach Miller/Rollnick
Bei der Motivierenden Gesprächsführung (MI) handelt es sich um eine Gesprächstechnik, die von William R. Miller und Stephen Rollnick entwickelt wurde. Die Gesprächstechnik findet in einem breiten Spektrum von Themengebieten und Settings Anwendung, obwohl sie ursprünglich für die Begleitung und Beratung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankung entwickelt wurde (Miller & Rollnick, 2015, S. 11).
MI wurde konzipiert, um in Beratung oder Therapie effektive Gespräche über Veränderungen zu führen und bietet zudem eine konstruktive Möglichkeit, die Motivation einer ratsuchenden Person für Veränderung zu wecken oder zu stärken. Gespräche werden dabei so gestaltet, dass Menschen auf der Grundlage ihrer eignen Werte und Interessen von selbst die Sprache auf das Thema Veränderung bringen. Die dahinterstehende Grundannahme ist, dass das gesprochene Wort in Richtung Veränderung, nicht nur den Wunsch nach Veränderung widerspiegelt, sondern aktiv formt (Miller & Rollnick, 2015, S. 18). Die Aufgabe der beratenden Person besteht demnach darin, die ratsuchende Person für ihren Weg zu ermutigen und zu begleiten, um neue Erfahrungen zu ermöglichen und die Selbstwirksamkeit zu fördern (Jähne & Schulz, 2018, S. 44).
Um diese Herangehensweise im Sinne der Gesprächstechnik umzusetzen, ist es entscheidend, die Ambivalenz der meisten Menschen gegenüber Veränderungen zu berücksichtigen. Ratsuchende besitzen bereits ihre eigenen Gründe dafür, warum sie etwas verändern wollen oder warum nicht. Nicht selten lassen sich in den Aussagen der ratsuchenden Person Widersprüche erkennen. Da es sich bei diesem Phänomen um eine natürliche menschliche Erfahrung handelt, greift MI diese Ambivalenzen gezielt auf und betrachtet sie als förderlichen Bestandteil des Veränderungsprozesses (Miller & Rollnick, 2015, S. 20-21). Durch das Aufdecken dieser Widersprüche erfährt die ratsuchende Person eine Dis- krepanz7 zwischen ihrem Verhalten und ihren inneren Werten sowie Interessen im Leben, die zur Verhaltensänderung beitragen soll. Die Motivation für eine Veränderung soll somit gestärkt und der Prozess der Veränderung angestoßen werden. Durch einen Prozess des geleiteten Entdeckens soll die ratsuchende Person zu einer Selbsterkenntnis gelangen, die sie annehmen und für die Veränderung ihres Verhaltens nutzen kann (Jähne & Schulz, 2018, S. 45-46). Das Beratungsgespräch der MI ist methodisch in vier aufeinander aufbauende Phasen gegliedert: Beziehungsaufbau, Fokussierung, Evokation und Planung (Miller und Rollnick, 2015, S. 44). Durch das gezielte Initiieren und Unterstützen von Veränderungsprozessen, wird die Beratungsform als direktiv definiert (Jähne & Schulz, 2018, S. 35).
MI basiert auf einem humanistischen Menschenbild und geht davon aus, dass Ratsuchende grundlegend den Wunsch und die Bereitschaft nach positiver Veränderung in sich tragen und diesen umsetzen können (Jähne & Schulz, 2018, S. 47). Die beraterische Grundhaltung orientiert sich dabei am personenzentrierten Modell von Rogers, bei dem die Perspektive der ratsuchenden Person stets im Mittel- punkt des Geschehens steht (Miller & Rollnick, 2015, S. 38). Wer motivierende Gespräche führen möchte, benötigt laut Miller und Rollnick (2015) vier Schlüsselelemente: Partnerschaftlichkeit, Akzeptanz, Mitgefühl und Evokation (S. 30).
Zusammenfand kann MI als personenzentrierter therapeutischer Stil beschrieben werden, der sich dafür eignet, mit Widerständen gegenüber Veränderungen umzugehen. Es handelt sich um einen kooperativen und zielorientierten Ansatz, mit einem besonderen Fokus auf die Sprache der Veränderung. Durch eine Atmosphäre von Akzeptanz und Mitgefühl, soll Selbsterkenntnis herbeigeführt und die persönliche Motivation zur Veränderung nachhaltig gestärkt werden (Miller & Rollnick, 2015, S. 50).
Beraterische Grundhaltung
Zu den wesentlichen Prinzipien der Gesprächstechnik von Miller und Rollnick gehören Partnerschaftlichkeit, Akzeptanz, Mitgefühl und Evokation. Das Zusammenspiel dieser vier Komponenten bildet die Grundhaltung, die die beratende Person gegenüber der ratsuchenden Person im Beratungsprozess einnimmt (Jähne & Schulz, 2018, S. 38-39).
Durch eine partnerschaftliche Haltung soll eine gleichberechtigte und respektvolle Beziehung zwischen den Gesprächspartnern entstehen, die einen kooperativen und mitwirkenden Veränderungsprozess zulässt. Ratsuchende werden als Experte oder Expertinnen in den Angelegenheiten angesehen, die sie selbst betreffen, mit umfangreichem Wissen bezüglich ihrer Situation. Partnerschaftlichkeit zeigt sich durch eine interessierte und dem Gesprächsfluss unterstützende, nachfragende Vorgehensweise und lässt eine positive zwischenmenschliche Atmosphäre entstehen, die für eine Verhaltensänderung dienlich ist, sie jedoch nicht herbeizwingt (Miller & Rollnick, 2015, S. 30-32).
Akzeptanz zeigt sich laut Miller und Rollnick durch Empathie, bedingungslose Wertschätzung, Würdigung und der Stärkung von Autonomie (2015, S. 32). Durch eine anerkennende und zugewandte Haltung erfährt eine Person Wertschätzung, was ihren Selbstwert stärkt und ihre Gesprächsbereitschaft erhöht. Zudem wirkt Akzeptanz richtungsweisend, da die ratsuchende Person eine bestimmte Gesprächsrichtung einschlagen kann, die von der beratenden Person respektiert und gefördert wird (Jähne & Schulz, 2018, S. 42).
Mitgefühl bezieht sich vor allem auf das aktive Tun der Arbeit, nicht auf ein „Mitleiden“ mit der anderen Person. Mit der mitfühlenden Haltung heben Miller und Rollnick hervor, wie wichtig es ist, im Sinne der ratsuchenden Person zu handeln. MI möchte stets die Interessen und das Wohl der Ratsuchenden wahren und in den Mittelpunkt des Geschehens stellen (2015, S. 36).
Evokation kann als geleitetes Entdecken verstanden werden und dient der Erkundung von inneren Prozessen. Beweggründe, welche für und gegen eine Veränderung sprechen, werden durch das evozieren wahrgenommen und erlebt. Die Veränderungsbereitschaft soll durch diesen Prozess gestärkt werden (Jähne & Schulz, 2018, S. 40). Laut Miller und Rollnick ist die Haltung der Evokation eng mit der Arbeit mit Diskrepanzen verbunden. Wer einer Veränderung ambivalent gegenübersteht, hat bereits alle Argumente im Blick, die für eine Veränderung sprechen, und diejenigen, die den Ausgangszustand stützen. Das Ziel der Evokation besteht darin, die vorhandene Motivation für die Veränderung hervorzurufen (zu evozieren) und zu stärken (2015, S. 37). Evokation ist ein wesentlicher Bestandteil von MI und findet sowohl in der beraterischen Grundhaltung, als auch in der direkten methodischen Arbeit Anwendung.
Methodische Grundlagen und Ziele
Neben der oben beschriebenen beraterischen Grundhaltung, die sich im gesamten Beratungsprozess widerspiegelt, erfordert die Anwendung von MI eine flexible und strategische Nutzung verschiedener kommunikativer Kompetenzen (Hill, 2009; Ivey, Ivey & Zalaquett, 2009, zitiert nach Miller & Rollnick, 2015, S. 51). Miller und Rollnick (2015) beschreiben für motivierende Beratungsgespräche fünf kommunikative Kernkompetenzen, deren Gebrauch im gesamten MI-Prozess flexibel erfolgt (S. 51).
Das stellen von offenen Fragen. Mittels offener Fragen wird dem Gegenüber wertschätzendes Interesse signalisiert und ein positiver Beziehungsaufbau unterstützt (Jähne & Schulz, 2018, S. 57). Der Gesprächsfluss wird durch diese Fragetechnik angeregt und fördert einen aktiven Austausch, wodurch sich erste Themen und Richtungen für den Beratungsprozess erkennen lassen. Offene Fragen ermutigen zu ausführlichen Antworten, während geschlossene Fragen eher kurze Antworten zulassen (Miller & Rollnick, 2015, S. 86-87).
Würdigung. Neben dem stellen von offenen Fragen ist die Würdigung eine weitere wichtige Fähigkeit, die im MI-Prozess Verwendung finden sollte. Würdigung bedeutet, zu erkennen und anzuerkennen, was gut ist. Grundsätzlich gehört hierzu der jedem Menschen innewohnende Wert. Würdigung zeigt sich beispielsweise in einen Kommentar zu einer positiven Eigenschaft oder Verhaltensweise einer Person. Durch Würdigung stärkt sich die Beratungsbeziehung und der Selbstwert der ratsuchenden Person (Miller & Rollnick, 2015, S. 87-90). Zudem kann Würdigung zu einem kooperativen und positiven Beratungsverlauf beitragen, da sie Ratsuchende für weitere Beratungsgespräche motiviert (Linehan et al., 2002, zitiert nach Miller & Rollnick, 2015, S. 88).
Reflektiertes Zuhören, eine weitere fundamentale Gesprächskompetenz für MI, hat die wichtige Funktion, zu klären, ob das Gesagte der Ratsuchenden richtig verstanden wurde. Sie geben der beratenen Person die Möglichkeit, die geäußerten Gedanken und Gefühle erneut zu hören, und gegebenenfalls zu korrigieren. Das gegenseitige Verständnis wird vertieft (Miller & Rollnick, 2015, S. 87-90). Reflektiertes Zuhören leistet einen wichtigen Beitrag für den Aufbau einer tragfähigen Beratungsbeziehung (Jähne & Schulz, 2018, S. 72).
Das Zusammenfassen von Gesprächsinhalten gleicht dem reflektierten Zuhören, wird jedoch von Miller und Rollnick (2015) als ein Bündeln von besprochenen Inhalten verstanden. Diese Kompetenz signalisiert dem Gegenüber, dass das Gesagte gemerkt und verstanden wurde (S. 53). Gedankengänge können der ratsuchenden Person strukturiert wiedergegeben werden. Dadurch werden Zusammenhänge sichtbar und bieten Orientierung innerhalb eines Themas. Zusammenfassungen eignen sich, um Themenkomplexe abzuschließen, in ein neues Thema überzuleiten oder verschiedene Themen miteinander zu verbinden (Jähne & Schulz, 2018, S. 82-84).
Informieren und Ratschläge geben ist eine Kompetenz, die trotz der personenzentrierten Ausrichtung von MI Anwendung findet. Dabei ist es besonders wichtig, diese nicht ungefragt vorzubringen, sondern erst nach ausdrücklicher Erlaubnis oder auf Nachfrage. Zudem sollte darauf geachtet werden, Informationen nur dann zu geben, wenn die Sichtweisen und Bedürfnisse des Gegenübers gründlich verstanden wurden. Informationen und Ratschläge sind Angebote des Beratenden, welche die Ratsuchenden frei annehmen oder ablehnen können (Miller & Rollnick, 2015, S. 53-54).
Die Anwendung der fünf beschriebenen Kernkompetenzen ist unverzichtbare Voraussetzung für die sachkundige Nutzung von MI, durch deren strategischen Einsatz Ratsuchende Unterstützung für ihre Veränderung erfahren (Miller & Rollnick, 2015, S. 54).
Der Beratungsprozess der Motivierenden Gesprächsführung wird methodisch in vier Phasen unterteilt: Beziehungsaufbau, Fokussierung, Evokation und Planung. Die Phasen bauen aufeinander auf, verlaufen jedoch nicht strikt linear. Vielmehr gehen sie ineinander über, überschneiden sich oder wiederholen sich im Verlauf des Prozesses (Miller & Rollnick, 2015, S. 44).
Der Beziehungsaufbau ist darauf ausgerichtet, Kontakt und eine gute Arbeitsbeziehung zur ratsuchenden Person herzustellen. Diese bildet die Grundlage für alle weiteren Phasen und ermöglicht eine erfolgreiche inhaltliche Zusammenarbeit. Tragfähige Beziehungen zeichnen sich durch Akzeptanz und Wertschätzung aus, selbst in Situationen, in denen Ratsuchende Widerstand zeigen (Jähne & Schulz, 2018, S. 51). Für den Beziehungsaufbau eignet sich die Gesprächstechnik, die bei MI mit dem Akronym OARS bezeichnet wird. OARS steht für Open questions, Affirming, Reflekting und Summarizing und bezieht sich auf die zuvor erläuterten kommunikativen Grundtechniken: offene Fragen, Würdigung, Reflexion und Zusammenfassen. Im Beziehungsaufbau sind diese Techniken die elementaren Werk- zeuge, mit denen ein gegenseitiges Verständnis gefördert werden kann (Miller & Rollnick, 2015, S. 85).
Die Fokussierung ist die strategische Ausrichtung im MI-Prozess und soll den Beteiligten dabei helfen, sich darüber klar zu werden, ob, warum, wann und wie eine Veränderung aussehen könnte. Das gemeinsam angestrebte Ziel soll bestimmt werden (Miller & Rollnick, 2015, S. 115). Idealerweise ist man über die Richtung einig. Ist dies nicht der Fall, hilft der Fokussierungsprozess eine gemeinsame Richtung zu finden und im Rahmen der Möglichkeiten erreichbare Ziele abzustecken (Miller & Rollnick, 2015, S. 119). Damit die ratsuchende Person die für sie passende Richtung und geeigneten Ziele findet, raten Miller und Rollnick (2015), sich nicht zu früh auf eine bestimmte Richtung zu fokussieren. Vielmehr bedarf es eines strategischen Vorgehens, in dem erforderliche Schritte und Umstände genauer betrachtet werden. Agenda Mapping ist hierfür ein geeignetes Hilfsmittel, um einen Überblick zu gewinnen und Desorientierung zu vermeiden. Hierbei handelt es sich um ein Gespräch auf Metaebene, in dem mögliche Themen und Herausforderungen, die mit einer Veränderung auftreten können, identifiziert werden (S. 131). Ist eine tragfähige Beziehung aufgebaut und eine angestrebte Richtung fokussiert, folgt die nächste Gesprächsphase.
Die Evokation. Im Prozess des methodischen Evozierens können zwei Formen von Äußerungen unter- schieden werden, die im Beratungsgespräch auftreten. Äußerungen, die zugunsten der Veränderung sprachlich geäußert werden, werden als Change Talk bezeichnet (Miller & Rollnick, 2015, S. 189). Aussagen, die sich gegen eine Veränderung richten, nennt man Sustain Talk. Sustain Talk und Change Talk stehen gegensätzlich zueinander und treten häufig ganz selbstverständlich im selben Satz nebeneinander auf. In ihrem Zusammentreffen spiegelt sich die Ambivalenz der ratsuchenden Person wider (Miller & Rollnick, 2015, S. 21). Solange der Sustain Talk überwiegt oder Change Talk und Sustain Talk sich die Waage halten, wird es, von MI ausgehend, zu keiner nachhaltigen Veränderung kommen (Miller & Rollnick, 2015, S. 196). Demnach ist das Ziel der Evokation, den prozentualen Anteil zu verschieben, von Sustain zu Change Talk (Miller & Rollnick, 2015, S. 211). Hierbei kommt es besonders auf die beraterische Fertigkeit an, Change Talk in den Äußerungen zu erkennen und zu wissen, wie sie evoziert werden können (Miller & Rollnick, 2015, S. 185). Erste Anzeichen von Change Talk zeigen sich in Aussagen zu Wünschen, Fähigkeiten, Gründen und der Notwendigkeit einer Veränderung. Miller und Rollnick (2015) definieren solche Äußerungen als vorbereitenden Change Talk, der durch gezieltes Evozieren in mobilisierenden Change Talk geführt werden kann. Mobilisierender Change Talk zeigt sich durch Selbstverpflichtungssprache wie „Ich werde“, Aktivierungssprache wie „Ich möchte“ oder durch Aussagen, die von unternommenen Schritten berichten, beispielsweise: „Diese Woche habe ich …“ (S. 190- 193). Eine wesentliche Technik, um Change Talk zu erzeugen, ist das Stellen offener Fragen, die entsprechend mit Change Talk beantwortet werden. Diese Fragen können sich im vorbereitenden Change Talk auf die genannten Wünsche, Fähigkeiten, Gründe und Notwendigkeiten der ratsuchenden Person beziehen und aufbauend darauf auf die mobilisierenden Aspekte von Change Talk ausgerichtet sein (Miller & Rollnick, 2015, S. 203-205). Am Ende der Evokation sollte eine selbstverpflichtende Aussage zur Durchführung der angestrebten Veränderung herausgearbeitet werden (Jähne & Schulz, 2018, S. 53). Anzeichen dafür, dass eine Person bereit für einen Planungsprozess ist, sind die Zunahme von Change Talk, weniger Sustain Talk, Entschlossenheit, das Äußern von Zukunftsbildern, Berichte über bereits unternommene Schritte sowie Fragen zu möglichen Veränderungen (Miller & Rollnick, 2015, S. 304-308).
Die Planung bildet die vierte Phase des MI-Prozesses und erfordert dieselben Fertigkeiten, die für Beziehungsaufbau, Fokussierung und Evokation gebraucht werden (Miller & Rollnick, 2015, S. 316). Einen Plan für die Veränderung zu entwickeln bedeutet für Miller und Rollnick (2015), von einer Absichtsbekundung zu einem konkreten Umsetzungsplan zu kommen. Ausgangspunkt kann hierbei die grundlegende Entwicklung eines Plans sein, die Unterstützung bei der Entscheidung für einen Plan oder die detaillierte Ausarbeitung eines bestehenden Plans (S. 333). Für die Entwicklung von Veränderungsplänen beruft sich MI auf Erkenntnisse der Verhaltensforschung sowie auf bestehende Techniken und Konzepte. Laut Miller und Rollnick (2015) trägt MI selbst nur einen bescheidenen, aber unter Umständen entscheidenden Beitrag dazu bei, die Motivation zur Umsetzung einer Veränderung zu fördern (S. 315). Ebenso ratsam ist die gezielte Erarbeitung einer Rückfallprophylaxe, um auf Unvorhergesehenes strategisch reagieren zu können. Rückfälle können wertvolle Hinweise auf bisher übersehene Probleme liefern (Jähne & Schulz, 2018, S. 54).
Vorteile
MI findet heute über die Suchtberatung hinaus Anwendung in vielen Beratungsfeldern, in denen Menschen Unterstützung für selbstmotivierte oder wünschenswerte Veränderungen suchen. Auch bei notwendigen Veränderungen, etwa bei fremd- oder selbstgefährdenden Verhaltensweisen eignet sich diese Gesprächstechnik, da sie auf der Grundlage einer stabilen Arbeitsbeziehung eine Veränderungsmotivation hervorrufen kann (Weigl & Mikutta, 2019, S. 33-34). Positiv hervorzuheben ist zudem, dass sich MI gezielt mit Ambivalenzen auseinandersetzt und diese als förderlichen Bestandteil eines Veränderungsprozesses betrachtet. In diesem Zusammenhang betonen Miller und Rollnick (2015) die Wichtigkeit, Argumente der ratsuchenden Person, die für und gegen die Veränderung sprechen, gleichermaßen zu betrachten, ohne diese direkt entsprechend der eigenen beraterischen Vorstellung zu korrigieren (S. 20-22). Vielmehr setzt MI auf die Autonomie des Menschen und vertraut auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden, sich in eine positive Richtung entwickeln zu wollen (Miller & Rollnick, 2015, S. 114). Ein weiterer Vorteil von MI zeigt sich im Umgang mit Rückfällen. MI wirkt der negativen Konnotation von Rückfällen entgegen, indem diese bereits im Vorfeld thematisiert und relativiert werden. Dadurch wird das Gefühl des Scheiterns verringert, wodurch der Veränderungsprozess eher aufrechterhalten bleibt (Miller & Rollnick, 2015, S. 347).
Nachteile
Bei MI handelt es sich um ein handlungsorientiertes Vorgehen, das in der Konzeptualisierung schlicht erscheint, jedoch keinesfalls einfach zu erlernen ist und die Herausforderung einer ständigen Übung erfordert (Miller & Rollnick, 2009, zitiert nach Weigl & Mikutta, 2019, S. 35). Zudem benötigen beratende Personen die Kompetenz, die Gesprächstechnik kontinuierlich an die ratsuchende Person und ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Insbesondere für Menschen in akuten Belastungssituationen oder mit psychiatrischen Einschränkungen ist dies erforderlich, da MI eine hohe kognitive Fähigkeit voraussetzt, um Veränderungsprozesse differenziert und reflektiert betrachten zu können (Jähne & Schulz, 2018, S. 173). Ein weiterer Nachteil, der den MI-Prozess einschränken kann, ist die begrenzte zeitliche Ressource der beratenden Person. Das Geben von Ratschlägen und Informationen kann hier schnell zum Mittel der Wahl werden, um ratsuchende Personen zügig auf den Weg der Veränderung zu bringen, ohne eine tiefere und nachhaltigere Veränderungsmotivation bei der Person aufzubauen (Weigl & Mikutta, 2019, S. 34). Zu guter Letzt gibt es Bedenken gegenüber MI und seiner Wirkung, die in seinem Potenzial Gründen, sowohl die Willensbildung und Entscheidung als auch damit zusammenhängende Verhaltensweisen zu beeinflussen (Miller und Rollnick, 2015, S. 152).
Vergleich beider Gesprächstechniken
Beide Gesprächstechniken basieren auf einem humanistischen Menschenbild (Hellwig, 2020; Jähne & Schulz, 2018). Eine tragfähige Beratungsbeziehung wird hierbei für den Erfolg einer Beratung bei beiden Gesprächstechniken vorausgesetzt. Dies spiegelt sich jeweils in den beraterischen Grundhaltungen wider, wonach die Perspektive der ratsuchenden Personen stets im Mittelpunkt des Geschehens stehen (Miller & Rollnick, 2015; Weinberger, 2013). Bei den methodischen Grundlagen können wesentliche Unterschiede aufgezeigt werden.
So zum Beispiel wird die KZG als non-direktiv definiert, weil der Beratungsschwerpunkt dieser Technik darin liegt, das Verhalten einer ratsuchenden Person, ohne direktes methodisches Eingreifen zu akzeptieren (Schuster, 2020, S. 48). Dadurch soll die innere Motivation gestärkt werden, die zur Entwicklung und Umsetzung individueller Fähigkeiten antreibt (Hellwig, 2020, S. 8). Die Effektivität dieser Gesprächstechnik beruht vor allem auf der beraterischen Grundhaltung, aus der sich die in den methodischen Grundlagen beschriebenen Methoden ableiten (Finke, 2009, zitiert nach Weinberger, 2013, S. 32). Aufgrund dieser unkonkreten Methodenbeschreibung wird die Gesprächstechnik als Lückenhaft wahrgenommen und eine weitere Auseinandersetzung mit den einzelnen Bausteinen der Grundhaltung wird als notwendig betrachtet (Büttner & Quindel, 2013, S. 60-61). Dennoch konnte die Wirksamkeit der KZG durch einige Studien und einer Metaanalyse im Jahr 1994 von Grawe et al. belegt werden (Revenstorf, 2009, S. 298). Somit gehört die Gesprächstechnik von Rogers heute zu den bedeutendsten Methoden in der Beratungs- und Therapielandschaft (Weinberger, 2013, S. 32).
Auch die Motivierende Gesprächsführung von Miller und Rollnick hat sich über ihre Ursprünge in der Suchtberatung hinwegentwickelt und findet heute in vielen Beratungsfeldern Anwendung (Miller & Roll- nick, 2015, S. 11). Bei MI handelt sich um einen kooperativen und zielgerichteten Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Sprache der Veränderung steht. Die Gesprächstechnik eignet sich besonders, um mit Widerständen gegenüber Veränderungen umzugehen (Miller & Rollnick, 2015, S. 50). MI zeichnet sich durch eine klar strukturierte Vorgehensweise aus, die in vier Prozesse gegliedert ist. Vor allem durch die Prozesse der Fokussierung, Evokation und Planung lässt sich MI eindeutig als direktiv definieren, da in diesen Phasen eine klare strategische Ausrichtung gegeben ist (Miller & Rollnick, 2015, S. 54). Bei MI gibt es im Vergleich zur KZG durchaus Situationen, in denen das Geben von Ratschlägen und Informationen legitim ist, zum Beispiel, wenn danach gefragt wird oder die beratende Person ein entsprechendes Angebot macht. Zudem beschreibt MI ein methodisches Vorgehen und vermittelt Fertigkeiten, die gezielt eingesetzt werden, um Personen bei einer Veränderung zu unterstützen (Miller & Rollnick, 2015, S. 53-54). Trotz der direktiven Ausrichtung, setzt auch MI auf die Autonomie der Ratsuchenden und dem inneren Bedürfnis des Menschen, sich in eine positive Richtung entwickeln zu wollen (Miller & Rollnick, 2015, S. 114).
Fazit
In dieser Arbeit wurden die Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers und die Motivierende Gesprächsführung nach Miller und Rollnick miteinander verglichen. Dabei wurden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede verdeutlicht, insbesondere im Hinblick auf die beraterische Grundhaltung und die methodische Vorgehensweise. Beide Gesprächstechniken basieren auf einem humanistischen Menschenbild und betrachten eine tragfähige Beratungsbeziehung als essentiell (Hellwig, 2020; Jähne & Schulz, 2018). Die beschriebenen Gesprächstechniken unterscheiden sich methodisch. Dabei weist MI eine gezieltere und strukturierte Gesprächsführung auf (Weigl & Mikutta, 2019, S. 10). Des Weiteren wurden Vor- und Nachteile beider Techniken dargelegt, um somit ein differenziertes Verständnis für deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen zu ermöglichen. Professionelle Berater und Beraterinnen bedienen sich neben den hier beschriebenen Techniken auch vieler weiteren Methoden zur praktischen Umsetzung einer sowohl zielgerichteten als auch offenen und dynamischen Beratung (Kämpfe, 2019, S. 255-256). Im Kontext einer Beratung ist die ausschließliche Fokussierung auf eine bestimmte Beratungsmethode nicht zielführend. Gute Beratung sollte sich demnach durch eine Methodenvielfalt auszeichnen (Kämpfe, 2019, S. 261, 271) und ist mehr als eine gute Gesprächsführung (Zwicker-Pelzer, 2010, zitiert nach Schubert et al., 2019. S.165).
Literaturverzeichnis
Altmann, T. (2015). Empathie in sozialen und Pflegeberufen: Entwicklung und Evaluation eines Trainingsprogramms. Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06645-1
Büttner, C. & Quindel, R. (2013). Gesprächsführung und Beratung: Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch. Springer Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30212-1
Deutsche Gesellschaft für Beratung/German Association for Counseling e.V. (2020). Beratungsverständnis. https://dachverband-beratung.de/beratungsverstaendnis/
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (2023). Ethik-Richtlinien der DGSF. https://dgsf.org/ueber-uns/ethik-richtlinien.htm
Engel, F., Nestmann, F. & Sickendiek, U. (2018). Beratung: alte Selbstverständnisse und neue Entwicklungen. In S. Rietmann & M. Sawatzki (Hrsg.), Zukunft der Beratung: Von der Verhaltens- zur Verhältnisorientierung? (S. 83-115). Springer VS Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3- 658-18009-6
Fischer, C., (2021). Was bringe ich mit? Grundhaltung und theoretischer Hintergrund. In C. Fischer & Frey (Hrsg.), Praxishandbuch Psychiatrische Krisenintervention: Erste Hilfe bei psychischen Krisen aus interdisziplinärer Sicht (S. 35-57). Elsevier.
Fuhr, R. (2003). Struktur und Dynamik der Berater-Klienten-Beziehung. In C. Krause, B. Fittkau, R. Fuhr & H.-U. Thiel (Hrsg.), Pädagogische Beratung: Grundlagen und Praxisanwendung (S. 32- 50). Schöningh.
Gerrig, R. J. (2018). Die menschliche Persönlichkeit: Humanistische Theorien. In T. Dörfler & J. Roos (Hrsg.), Psychologie (21., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 507-547). Pearson.
Hellwig, C. (2017). Personenzentrierte Gesprächsführung. In A. Schlüter & K. Kress (Hrsg.), Methoden und Techniken der Bildungsberatung (S. 82-88). http://library.oa- pen.org/handle/20.500.12657/28376
Hellwig, C. (2020). Personzentriert-integrative Gesprächsführung im Coaching: Zuhören-Verstehen- Intervenieren (2. Aufl.). Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29118-1
Hellwig, C. (2022). Wertebasierte Gesprächsführung: Wirkprinzipien der Personenzentrierten Theorie (2. Aufl.). Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39674-9
Jähne, A., & Schulz, C. (2018). Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung: Für Beratung, Therapie und Coaching. Junfermann Verlag.
Kämpfe, N. (2019). Pädagogische Beratung. In B. Kracke & P. Noack (Hrsg.), Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie (S. 249–274). Springer Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-53968-8
Lammers, C.-H. (2017). Techniken der Gesprächsführung. In P. Neudeck (Hrsg.), Therapeutische Be- ziehung und Gesprächsführung: Techniken der Verhaltenstherapie (S. 90-135). Beltz.
Lerch, S. & Weitzel, H. (2024). Beratung für lebensentfaltende Bildung. Zeitschrift für Weiterbildungsforschung, 47(2), 47-62. https://doi.org/10.1007/s40955-024-00273-1
Revenstorf, D. (2009) Verhaltenstherapie und andere Therapieformen. In J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren, Rahmenbedingungen (3. Aufl., S.297-312). Springer Medizin Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79541-4
Miller, W. R. & Rollnick, S. (2015). Motivierende Gesprächsführung: Motivational Interviewing (3. Auf- lage des Standardwerks in Deutsch). Lambertus-Verlag.
Traumann, U. E. (2007). Klientenzentrierte Beratung. In F. Nestmann, F. Engel & U. Sickendiek (Hrsg.), Das Handbuch der Beratung. Band 2: Ansätze, Methoden und Felder (2. Aufl., S. 641- 654). dgvt-Verlag.
Niggemeier, A. (2019). Die Ausbildung zum Berater: Für eine kompetente Beratung in Organisationen. Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25767-5
Plate, M. (2021). Grundlagen der Kommunikation: Gespräche effektiv gestalten (3. erg. Aufl.). Vandenhoeck & Ruprecht. https://doi.org/10.36198/9783838556499
Schubert, F.-C., Rohr, D. & Zwicker-Pelzer, R. (2019). Beratung: Grundlagen-Konzepte-Anwendungsfelder. Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20844-8
Schuster, B. (2020). Führung im Klassenzimmer: Disziplinschwierigkeiten und sozialen Störungen effektiv begegnen – der LMU-Leitfaden für Miteinander im Unterricht (2. Aufl.). Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27509-9
Stimmer, F. (2020). Grundlagen des methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit (4. aktualisierte Aufl.). Kohlhammer Verlag. https://ebookcentral.proquest.com/lib/badhonnef/detail.ac-tion?docID=6207238
Weigl, T. & Mikutta, J. (2019). Motivierende Gesprächsführung: Eine Einführung. Springer Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24481-1
Weinberger, S. (2013). Klientenzentrierte Gesprächsführung: Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe (14. Aufl.). Beltz Juventa.